Pflege nach einem Schlaganfall
Ein Schlaganfall kann verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Hirnareale betreffen. Deshalb sind nicht alle Patienten nach einem Schlaganfall gleich.
Die möglichen Beeinträchtigungen reichen von leichten sprachlichen und motorischen Defiziten bis hin zu schweren körperlichen und geistigen Funktionsstörungen.
Einige Patienten haben Glück: Sie überstehen einen Schlaganfall ohne Langzeitfolgen.
Wohnen im Alter zeigt in diesem Artikel welche Folgen ein Schlaganfall haben kann und wie man einen Patienten am besten pflegt.
Was ist ein Schlaganfall? Was ist ein Schlaganfall?
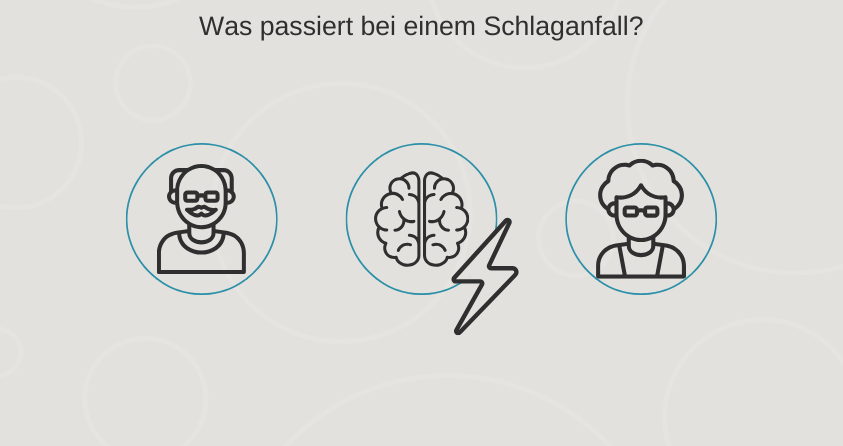
Grundsätzlich wird bei einem Schlaganfall zwischen zwei wesentlichen Arten unterschieden:
TIA
Bei einer TIA tritt eine vorübergehend neurologische Störung auf, die den Symptomen eines Schlaganfalls gleicht, sich aber im Verlauf von maximal 24 Stunden wieder vollständig zurückbildet. Eine TIA wird durch Durchblutungsstörungen im Gehirn hervorgerufen. Erste Symptome treten meistens im Zeitraum von 2 Minuten bis zu Stunden auf. TIA’s müssen als Warnzeichen ernst genommen werden und deren Ursache medizinisch abgeklärt werden.
PRIND
Bei einem PRIND handelt es sich um eine verzögert verlaufende Durchblutungsstörung. Die Zeit der symptomatischen Entwicklung beträgt ca. 24-28 Stunden. Der Zeitraum der Rückbildung der Symptome verläuft sich auf bis zu drei Wochen. Bei einem PRIND muss der Betroffene sofort in medizinische Behandlung in ein Krankenhaus.
Eine häufige Ursache des Schlaganfalls ist eine Thrombose in einer Arterie, die das Gehirn mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Wenn die Nervenzellen keinen Sauerstoff und keine Energie erhalten, stellen sie ihre Funktion ein und sterben bereits nach wenigen Minuten ab.
Die Schwere eines Schlaganfalls hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn eine große Arterie verstopft ist, staut sich mehr Blut, das nun nicht mehr ins Gehirn gelangt. Je größer das betroffene Gebiet ist, desto schwerwiegender sind die Auswirkungen.
Weitere Unterschiede hängen damit zusammen, welches Hirnareal wegen der Durchblutungsstörung unterversorgt wird. Verschiedene Bereiche des Gehirns sind für verschiedene Aufgaben zuständig. Zum Beispiel gibt es ein motorisches Zentrum, ein Hirnareal für das Verstehen von Sprache, ein Sprechzentrum und viele weitere Spezialbereiche. Da die Nervenzellen miteinander verknüpft sind, kann der Ausfall der Nervenzellen in einem Bereich auch Auswirkungen auf andere Hirnbereiche haben.
Frühsymptome
Seh- und Hörstörungen
Störungen der Sprache und/ oder des Sprachverständnisses
Taubheitsgefühl in Armen oder Beinen
Gleichgewichtsstörungen meist mit Kombination von Schwindel
Probleme beim Rechnen, Lesen und Schreiben
Wie pflegebedürftig ist ein Mensch nach einem Schlaganfall? Wie pflegebedürftig ist ein Mensch nach einem Schlaganfall?
Die Pflegebedürftigkeit hängt immer von den individuellen Umständen ab, da nicht jeder Schlaganfall dieselben Auswirkungen hat. Je nach Schweregrad kann eine Pflegestufe beantragt werden, um ggf. zusätzliche Unterstützung zu erhalten.
An die Zeit nach dem Krankenhaus schließt sich ggf. eine neurologische Rehabilitation an. Dort lernen Patienten in der Regel Übungen, die sie auch zuhause bzw. in einer Pflegeeinrichtung fortsetzen können. Je nach Beschwerden kann es sich dabei zum Beispiel um Sprechübungen oder motorische Übungen handeln.
Viele Schlaganfallspatienten möchten anschließend so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Solange die Pflege zuhause gewährleistet ist, sprechen in der Regel keine Gründe dagegen. Pflegende Angehörige oder ein ambulanter Pflegedienst können sie vor allem beim morgendlichen und abendlichen Umkleiden und bei der Körperpflege unterstützen.
Eine weitere Versorgungsmöglichkeit bietet das Pflegeheim. Wenn Senioren dort einen Platz erhalten, bekommen sie ein Zimmer und professionelle Unterstützung, die sich an ihren individuellen Pflegebedarf orientiert.
Die Pflege zu Hause Die Pflege zu Hause

Kann ein Angehöriger sich nicht viel bewegen, muss darauf geachtet werden, dass er sich nicht wund liegt oder sitzt. Es gilt regelmäßig die Position im Bett oder Sessel mit Hilfe von Transferhilfen zu verändern.
Vielseitige Aktivitäten sind wichtig, auch wenn diese anfangs noch nicht gut gelingen. Nicht nur der Patient, auch der pflegende Angehörige selbst braucht eine gute Portion Geduld. Es ist notwendig, sich für die Pflege ausreichend Zeit zu nehmen - für alle Vorgänge wird die nötige Ruhe benötigt.
Das gilt auch für die Körperpflege und das An- sowie Auskleiden. Den Angehörigen zu duschen ist besser als ihn zu baden. Es regt den Kreislauf an und ist einfacher durchzuführen, vor allem, wenn ein Duschhocker verwendet wird. Beim Ankleiden sollte darauf geachtet werden, Kleidung auszuwählen, die sich leicht anziehen lässt.
Den Angehörigen regelmäßig ans Trinken zu erinnen, ist ebenfalls wichtig. Es kann sein, dass sich die betroffene Person hierbei zurückhält, wenn durch den Schlaganfall eine Blasenschwäche zurückbehalten wurde. Der Pflegebedürftige muss jedoch viel Flüssigkeit zu sich nehmen, um einem weiteren Hirnschlag vorzubeugen. Inkontinenzmaterial, um Kleidung zu schützen, ist genau dann nützlich, wenn es einmal nicht rechtzeitig zur Toilette reicht.
Häufige Beschwerden nach einem Schlaganfall Häufige Beschwerden nach einem Schlaganfall
Obwohl die Einschränkungen und Beschwerden nach einem Schlaganfall bei jedem Betroffenen anders sein können, treten bestimmte Beschwerden besonders häufig auf. Dazu gehören:
Schluckstörungen
Sprechstörungen
motorische Probleme
kognitive Beeinträchtigungen
Zum Teil lernen Patienten und Angehörige bereits im Krankenhaus oder in der Rehabilitation spezielle Übungen, die sie gemeinsam in den Pflege-Alltag integrieren können.
Schluckstörungen
Viele Menschen leiden nach einen Schlaganfall unter Schluckbeschwerden. Diese können die Pflege erschweren, da der Betroffene möglicherweise Unterstützung beim Essen und Trinken benötigt. Auch das Kauen kann dadurch erschwert sein. Schluckstörungen erhöhen die Gefahr dafür, dass Speichel, Speisen oder Getränke in die Luftröhre gelangen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch zu Komplikationen führen. In ungünstigen Fällen können die Fremdkörper das Lungengewebe zerstören oder Infektionen hervorrufen. Auch eine Lungenentzündung ist möglich.
Fremdkörper wie Speisebröckchen, die in die Lunge geraten, können häufig von einem Arzt mithilfe eines Endoskops wieder entfernt werden. Der Arzt entscheidet über die Behandlung. Zuvor wird in der Regel festgestellt, ob sich tatsächlich ein Fremdkörper in der Lunge besteht und ob ggf. Risiken zu erwarten sind.
Sprechstörungen
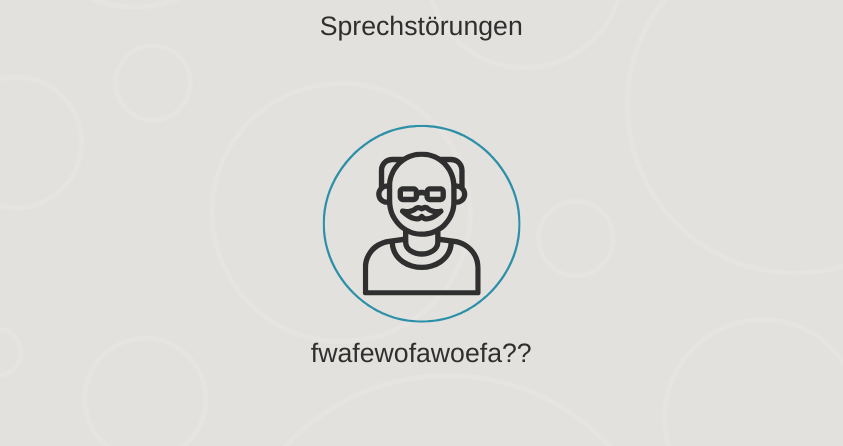
Die Schluckstörungen und die Sprechstörungen nach einem Schlaganfall gehen häufig auf eine gemeinsame Ursache zurück. Ein Hirnnerv, der direkt vom Gehirn zum Gesicht führt, kann durch den Schlaganfall beschädigt sein. Dieser Nerv versorgt normalerweise die Muskeln in Zunge, Rachen, Mund und Kiefer mit elektrischen Signalen. Wenn diese Signale (teilweise) ausbleiben, funktioniert die empfindliche Koordination der unterschiedlichen Muskeln oft nicht mehr.
Darüber hinaus können auch die sensiblen Nervenfasern beschädigt sein, die dem Gehirn Informationen aus dem Gewebe zurückmelden - zum Beispiel über Druckreize. Auch solche sensiblen Störungen können dazu beitragen, dass die Koordination der Sprechmuskulatur nicht mehr gelingt
Sprechstörungen bedeutet für Pfleger oft eine Herausforderung. Bei einigen Betroffenen ist die Sprechstörung nur leicht ausgeprägt: Sie sprechen langsam und schleppend, sind aber ansonsten noch recht gut zu verstehen. In anderen Fällen führen die Sprechstörungen dazu, dass der Betroffene kaum noch zu verstehen ist. Dies kann die Kommunikation beeinträchtigen und Missverständnisse zwischen dem Senioren und dem Pfleger begünstigen.
Eventuell ist eine spezielle Sprachtherapie möglich, um das Sprechen zu verbessern und/oder die Schluckmuskulatur zu trainieren.
Motorische Probleme
Viele Schlaganfallspatienten leiden nach dem Hirnschlag unter motorischen Störungen. Typischerweise ist davon nur eine Körperhälfte betroffen. Die Körperseite mit den motorischen Problemen liegt der Hirnhälfte, in der sich der Schlaganfall ereignet hat, gegenüber. Es handelt sich also um die kontralaterale Seite.
Trotz der motorischen Schwierigkeiten ist es bei der Pflege von Menschen nach einem Schlaganfall oft sinnvoll, den Patienten weiterhin zu fördern und zu fordern. Das Gehirn ist bis zu einem gewissen Grad flexibel: Zum Teil können andere Hirnareale (Teil-)Aufgaben übernehmen, die vom geschädigten Hirngewebe nicht mehr ausgeführt werden können. Dieses Umlernen ist zwar nur begrenzt möglich, doch es erfordert stete Übung und Stimulation.
Im Pflege-Alltag stehen berufliche Pfleger, aber auch Familienangehörige dabei oft vor einem Konflikt: Wenn der Patient zum Anziehen eines Pullovers mit Assistenz sehr viel Zeit benötigt, ist es unter neurologischen Gesichtspunkten dennoch sinnvoll, Geduld zu haben und ihn dabei zu unterstützen - denn so werden die verbleibenden Nervenzellen im Gehirn gefördert. Oft geht es jedoch schneller, den Patienten anzuziehen, während dieser nur ein wenig mithilft und ansonsten passiv bleibt.
Häufig lohnt es sich, wenn der Betroffene nach dem Schlaganfall auch körperlich aktiv bleibt. Ergo- und Physiotherapie bzw. Krankengymnastik kommen dazu infrage. Eventuell ist eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse möglich, wenn die Therapie vom Arzt angeordnet wird. Gleichzeitig ist es wichtig, das Risiko für Stürze, Überlastungen und Verletzungen so gering wie möglich zu halten.
Kognitive Beeinträchtigungen
Auch das Sprachverstehen, das Erkennen von Objekten und andere kognitive Funktionen können nach einem Schlaganfall beeinträchtigt sein. Doch nicht immer gehen diese Ausfälle mit einem Verlust der allgemeinen Intelligenz einher. Die eventuellen kognitiven Beeinträchtigungen nach einem Schlaganfall können sehr eng eingegrenzt sein.
Für Betroffene bedeutet das: Auch wenn sie sich vielleicht nicht mehr problemlos mitteilen können, kann sich in ihrem Kopf ein wacher Verstand befinden. Pfleger und Angehörige sollten deshalb empathisch vorgehen und die vorhandenen Defizite berücksichtigen, ohne den Betroffenen pauschal für minderintelligent zu halten und ohne ihn auf seine Schwächen zu reduzieren.
Das Bobath-Konzept Das Bobath-Konzept
Das Bobath Konzept ist ein Therapieansatz, der sehr häufig bei Schlaganfällen angewendet wird. Es vereint mehrere Therapien miteinander, um dem Patienten möglichst vielseitig und auf allen Ebenen helfen zu können.
Nach einer Analyse der vorhandenen Bewegungsmuster soll dieser unter verschiedenen Alltagsbedingungen die normalen Bewegungen wieder erlernen.
Ist der Angehörige stark eingeschränkt, wird ein Therapeut sie Bewegungen anfangs unterstützen und anleiten. Durch manuellen Druck auf verschiedene Körperstellen gibt der Therapeut Informationen an das Nervensystem des Patienten weiter, damit dieser seine Bewegungen leichter und geschickter ausführen kann.
Eine weitere Hilfe ist die Anpassung der Umgebung an die Bedürfnisse des Angehörigen. Häufiges und vielseitiges Üben verbessert den Gesundheitszustand schneller und nachhaltiger.
Unterforderung und Depressivität vermeiden Unterforderung und Depressivität vermeiden
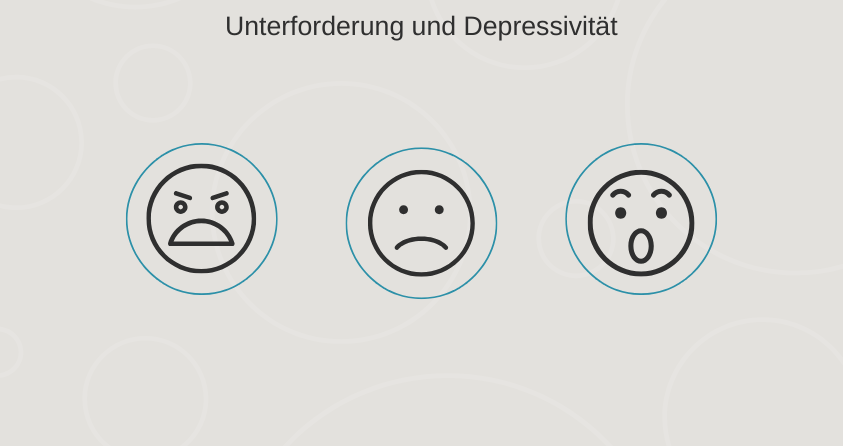
Die körperlichen Auswirkungen eines Schlaganfalls können sich indirekt auf die Psyche auswirken. Einige Betroffene fühlen sich nach dem Schlaganfall nutzlos oder unerwünscht. Aus solchen Gefühlen kann sich eine tiefe Niedergeschlagenheit entwickeln, die bis zur klinischen Depression reicht.
Für Schlaganfallspatienten ist das ungünstig - denn Depressionen führen häufig dazu, dass sich die Betroffenen zurückziehen und weniger zutrauen. Möglicherweise bewegen sie sich auch weniger. All kann dazu beitragen, dass sich der Zustand nach dem Schlaganfall nicht bessert oder sogar verschlechtert.
Nicht nur Muskeln und Nerven profitieren nach einem Schlaganfall oft von einer anregenden Umgebung, sondern auch der Geist. Neben sanften sportlichen Aktivitäten, die auf die individuellen Fähigkeiten abgestimmt sind, können deshalb auch geistige Beschäftigungen wie Lesen oder Rätsellösen von Vorteil sein.
Jeder Schlaganfall ist anders Jeder Schlaganfall ist anders
Nach einem Schlaganfall ist immer eine individuelle Abwägung der Umstände erforderlich. Sowohl Überforderung als auch Unterforderung können negative Folgen nach sich ziehen. Da die Auswirkungen des Schlaganfalls bei jedem Betroffenen anders sind, stellen auch die Anregungen in diesem Artikel lediglich allgemeine Möglichkeiten dar.
Im Krankenhaus und bei der anschließenden Reha erhalten die Betroffenen von Fachleuten eine individuelle Einschätzung und Empfehlungen, die auf sie persönlich abgestimmt sind. Im Zweifelsfall sollten sich die Patienten an ihren Arzt wenden und gezielt nach Fördermaßnahmen und anderen Möglichkeiten fragen.

Pflegeexperte Florian Seybecke
Fachliche Expertise
Schulungsbeauftragter und Dozent
Fachkoordinator für neurologische Langzeitrehabilitation
Pflegedienstleitung und Schulungsbeauftragter
Fachkraft in der außerklinischen Intensivpflege
Ausbildung zum examinierten Altenpfleger






