Erbschaftsteuer für pflegende Angehörige
Wer in einem Testament als Erbe bedacht wurde, sieht sich häufig gesetzlichen Normen gegenüber, die nicht jeder Laie sofort versteht. Die Erbschaft muss grundsätzlich beim Finanzamt angegeben werden, damit dort festgestellt wird, ob für das Erbe eine Erbschaftssteuer erhoben werden muss.
Wie hoch die Erbschaftssteuer ist, richtet sich nach einigen Gesichtspunkten wie Verwandtschaftsgrad, Höhe der Erbschaft sowie Steuerklasse. Doch es gibt auch Freibeträge. Wohnen im Alter erklärt in diesem Ratgeber worauf bei der Erbschaftssteuer zu achten ist.
Definition Erbschaftssteuer Definition Erbschaftssteuer
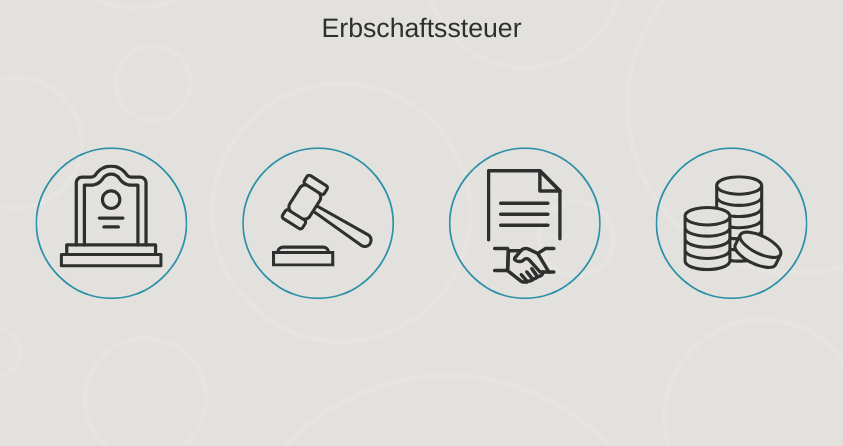
Erbschaften unterliegen in Deutschland grundsätzlich der Erbschaftssteuer. Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Steuer ergibt sich aus dem Erbschaftsteuer- sowie Schenkungsteuergesetz (ErbStG).
Nahe Angehörige, die beerbt wurden, profitieren von der gesetzlichen Regelung. Denn der Gesetzgeber hat relativ hohe Freibeträge für die Erbschaft festgelegt. In Deutschland sind daher lediglich die Erben von der Erbschaftssteuer betroffen, denen ein hohes Vermögen vererbt wird. Die Erbschaftssteuer kann, ab dieser gewissen Grenze, anhand der Höhe des Erbes, dem Grad der Verwandtschaft sowie der Steuerklasse errechnet werden.
Worauf erhebt der Fiskus die Erbschaftssteuer? Worauf erhebt der Fiskus die Erbschaftssteuer?
Bei der Erbschaftssteuer ist von einem Erwerb von Todes wegen die Rede. Diese Eigentumsübertragungsformen kommen in Betracht:
Erbfall
Vermächtnis
geltend gemachter Pflichtteilsanspruch
Schenkung auf den Todesfall
vom Erblasser geschlossener Vertrag zugunsten Dritter
Die Freibeträge: Wie hoch sind sie und wie werden sie errechnet? Die Freibeträge: Wie hoch sind sie und wie werden sie errechnet?
Jeder Erbe kann einen persönlichen Freibetrag geltend machen. Die Höhe der Freibeträge richtet sich bei einer bestehenden Steuerpflicht danach, in welcher Steuerklasse der Erbe ist. Das ergibt sich aus § 16 ErbStG.
Die Freibeträge bemessen sich grundsätzlich danach, in welchem Verwandtschaftsverhältnis der Bedachte zu dem Erblasser stand. Dieses Gesetz wird häufig bei Schenkungen unter Lebenden genutzt. Denn die Freibeträge können alle zehn Jahre erneut genutzt werden.
Falls Eltern also hohe Vermögenswerte auf ihre Kinder übertragen möchten, empfiehlt es sich, dies bereits zu Lebzeiten zu machen, und dabei die Fristen für die Freigrenzen zu nutzen. Somit kann beispielsweise alle zehn Jahre ein Teil der Erbschaft erbschaftssteuerfrei an die Kinder übertragen werden.
Diese Freibetragsgrenzen ergeben sich aus dem Gesetz:
Im Weiteren gilt, dass Ehegatten sowie Kinder des Verstorbenen zusätzlich einen Versorgungsfreibetrag geltend machen dürfen, das ergibt sich aus § 17 ErbStG. Für die Ehepartner beträgt dieser Freibetrag 256.000 Euro. Bei den Kindern richtet sich der Freibetrag nach dem Alter. Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt er allerdings ab und entfällt ab dem 27. Lebensjahr.
Freibetragsgrenzen
Die gesetzlichen Freibetragsgrenzen gelten seit dem 1.1.2009 und sind bis heute unverändert geblieben.
Berechnung der Erbschaftssteuer nach Erbschaftssteuersätzen Berechnung der Erbschaftssteuer nach Erbschaftssteuersätzen
Die Höhe der Erbschaftssteuersätze ist progressiv gestaffelt. Sie richtet sich hauptsächlich nach der Steuerklasse, jedoch ebenso nach dem Umfang der Schenkung oder der Erbschaft. Der Steuersatz wird nach dem gesamten Vermögen des Erblassers bemessen.
In der folgenden Übersicht werden die entsprechenden Freibeträge, die sich nach dem Verwandtschaftsgrad sowie der Steuerklasse bemessen von der Erbschaft abgezogen. Der restliche Betrag unterliegt der prozentualen Steuer für die Erbschaft oder Schenkung. Bei Betriebsnachfolgern sind unabhängig von dem Verwandtschaftsverhältnis immer die Steuersätze der Steuerklasse I heranzuziehen. Die nachfolgende Tabellen bemisst sich nach den Steuersätzen für Erbschaften sowie Schenkungen nach den gesetzlichen Vorschriften ab dem 01.01.2009:
Beispiel
Wer als Ehepartner als einziger Erbe das Vermögen des Ehegatten in Höhe von zwei Millionen Euro erbt, kann zunächst einen Freibetrag von 500.000 Euro geltend machen. Dieser ist von der Erbschaft abzuziehen. Ehegatten sind der Steuerklasse I zuzuordnen, daher fällt ein Steuersatz in Höhe von 19 Prozent an. Der Erbschaftssteuerbetrag, der an das Finanzamt zu entrichten ist, beträgt daher 285.000 Euro. (2.000000-500.000)* 0.19 = 285.000
Erbschaftssteuer aus Immobilienwerten sowie Unternehmensanteilen Erbschaftssteuer aus Immobilienwerten sowie Unternehmensanteilen
In den wenigsten Fällen werden solche hohen Geldbeträge wie im Beispiel weitervererbt. Diese hohen Summen ergeben sich zumeist erst dann, wenn geldwerte Vorteile aus Immobilien oder Firmenanteilen berechnet werden. Dabei gibt es verschiedene Maßstäbe, um eine Bewertung durchzuführen.
Es gibt nämlich ebenso viele unterschiedliche Meinungen über den tatsächlichen Wert, den eine Erbschaft hat. Daher gibt es immer wieder Erben, die der Auffassung sind, dass die Grundlage zur Berechnung des Wertes des Erbes vom Finanzamt verkehrt angesetzt wurde. In einem solchen Fall ist es ratsam, einen Anwalt aufzusuchen, der sich auf das Erbrecht spezialisiert hat.
Wann muss die Erbschaft beim Finanzamt gemeldet werden? Wann muss die Erbschaft beim Finanzamt gemeldet werden?
Der Erbe muss seine steuerpflichtige Erbschaft innerhalb einer Frist beim zuständigen Finanzamt anzeigen. Ab der Kenntnis über eine Erbschaft beträgt diese Frist drei Monate. Diese Anzeigepflicht besteht jedoch nicht immer.
Sobald die Erbschaft auf einem Testament beruht, das von einem deutschen Gericht, einem in Deutschland zugelassenen Notar oder von einem deutschen Konsul eröffnet wurde, entfällt die Anzeigepflicht unter Umständen. Voraussetzung ist, dass zum Erwerb weder Grundbesitz, noch Betriebsvermögen und keine von einem Geldinstitut verwalteten Anteile einer Gesellschaft gehören. Außerdem gilt eine Ausnahme für Auslandsvermögen.
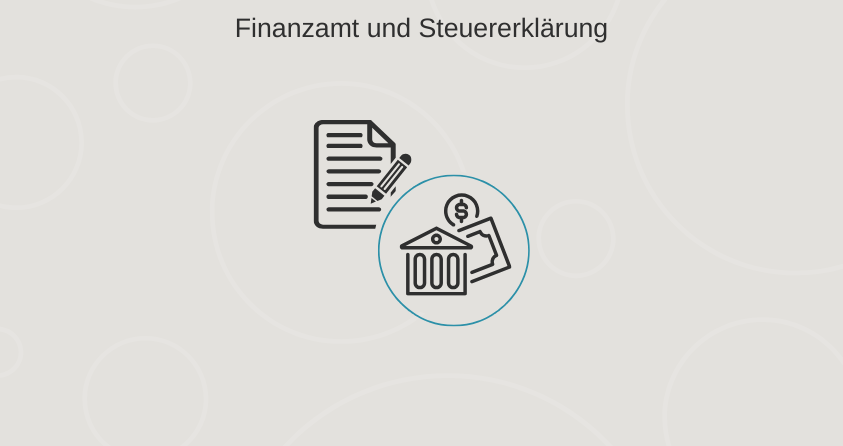
Wann muss die Steuererklärung vor dem Finanzamt abgegeben werden? Wann muss die Steuererklärung vor dem Finanzamt abgegeben werden?
Die Abgabe der Steuererklärung beim Finanzamt kann von jedem verlangt werden, der an dem Erbfall beteiligt ist. Das Finanzamt prüft zunächst anhand der Unterlagen, ob in einer ersten Schätzung eine Erbschaftssteuer abgeführt werden muss. Falls sich aus einer ersten groben Berechnung ergibt, dass Steuern fällig werden, wird der Erbe dazu aufgefordert, amtliche Steuererklärungsvordrucke beim Finanzamt einzureichen. Dazu wird in der Regel vom Fiskus eine Frist festgesetzt.
Doch die zu prüfenden Unterlagen können in den meisten Fällen erst nach und nach beim Finanzamt eingereicht werden. Denn Erbschaftssachen können sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Das sollten Erben immer bedenken, und sich darauf einstellen.
Freibeträge für Pflegeleistungen Freibeträge für Pflegeleistungen
Wenn ein verstorbener Angehörigen ohne Entgelt gepflegt wurde, gibt es einen zusätzlichen Freibetrag von 20.000 Euro als Anerkennung für die geleisteten Dienste. Anspruch darauf besteht allerdings nur, wenn der Pflegebedürftige dies in seinem Testament oder einer letztwilligen Verfügung vermerkt hat. Auch die Höhe der Leistungen kann dieser festhalten, indem er sich an den Tarifen eines Pflegedienstes orientiert.
Wenn neben der Pflege einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen wird, geht der Anspruch auf den Pflegefreibetrag bei der Erbschaft nicht verloren. Liegt kein Testament vor oder wurden die Pflegeleistungen nicht erwähnt, kann trotzdem ein finanzieller Ausgleich erhalten werden. Dieser wird nach den Sätzen der gesetzlichen Pflegeversicherung für häusliche Pflegeleistungen ermittelt.
Weiterführende Informationen
Autorin: Andrea Fettweis

Pflegeexperte Florian Seybecke
Fachliche Expertise
Schulungsbeauftragter und Dozent
Fachkoordinator für neurologische Langzeitrehabilitation
Pflegedienstleitung und Schulungsbeauftragter
Fachkraft in der außerklinischen Intensivpflege
Ausbildung zum examinierten Altenpfleger






