Belastungstest: Bereit für die Pflege eines Angehörigen?
Wird ein Familienmitglied pflegebedürftig, streben die meisten eine Versorgung im eigenen Zuhause an. Je nach Einschränkung kann die Pflegesituation jedoch eine große Herausforderung darstellen.
Nicht jeder fühlt sich in der Lage, dem Angehörigen z. B. bei der Körperpflege zu helfen. Viele Kinder übernehmen die Pflege ihrer Eltern aus Pflichtgefühl, obwohl dies eine Mehrfachbelastung für sie bedeutet. Bevor sich Angehörige aus Liebe zum Partner oder zum Elternteil für die Pflege entscheiden, sollten sie sich überlegen, ob sie belastbar genug sind.
Wohnen im Alter erklärt in diesem Ratgeber worauf Angehörige vor der Entscheidung zur Pflege achten und welche Fragen an sich gestellt werden sollten.
Pflege von Angehörigen Pflege von Angehörigen
Die Pflege von Angehörigen bedeutet, dass bei einer hilfe- und pflegebedürftigen Person die Pflege durch einen oder gleich mehrere Angehörige übernommen wird. Eine Pflege von Angehörigen umfasst eine pflegerische Versorgung, die in der Regel von Laien wie Ehrenamtlichen, Nachbarn oder Familienangehörigen übernommen wird.
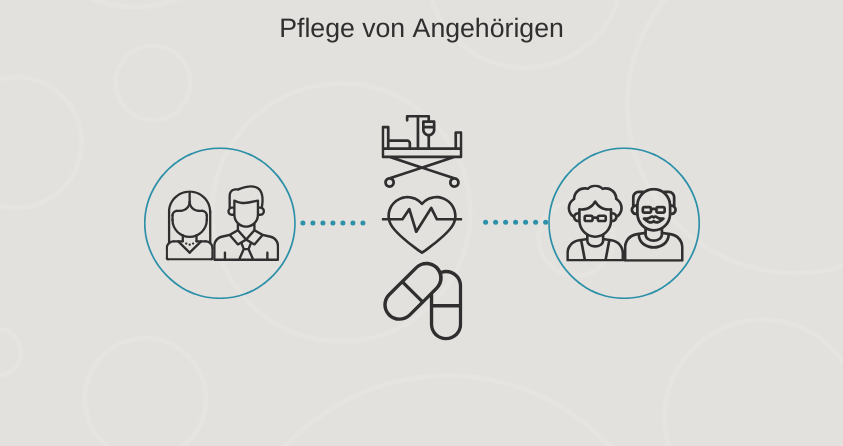
Wie soll der Angehörige also versorgt werden und ist es überhaupt möglich die Pflege mit der Familie und dem Beruf gut miteinander zu vereinbaren? Um diese Fragen zu beantworten sollten pflegende Personen in sich gehen und herausfinden, ob sie den Aufgaben gewachsen sind und sie sich die Pflege selbst zutrauen – ansonsten müssten Alternativen herangezogen werden.
Bei einer 24-Stunden-Pflege geht es um eine enorme psychische und körperliche Belastung. Auch müssen Pflegepersonen überprüfen, ob das eigene Zuhause eine Pflege überhaupt zulässt.
Viele betroffene Angehörige beschleicht oft ein Gefühl des Hin-und Hergerissenseins. Denn sie möchten auf der einen Seite die Angehörigen nicht ihrem Schicksal überlassen oder sie einfach in einem Pflegeheim einweisen. Auf der anderen Seite werden sie sich bewusst, wie stark sich das bisherige Leben durch die Pflege ändern wird.
Eine vollstationäre Pflege sollte nicht komplett als Option gestrichen werden. In diesem Fall können sich alle Familienangehörigen sicher sein, dass in einer stationären Einrichtung Fachpersonal zur Verfügung steht, das sich mit der Betreuung von Betroffenen genau auskennt. Die Pflegekräfte können die Familie vollständig entlasten. So bleibt ausreichend Zeit, um sich bewusst mit dem Angehörigen zu beschäftigen, Gespräche mit ihnen zu führen oder Ausflüge zu unternehmen.
Meistens nimmt ein etwaiger Umstand die Entscheidung zwischen einer stationären und ambulanten Pflege ab. So istes kaum möglich die Pflege durchzuführen, wenn die pflegende Person selber gesundheitlich angeschlagen, keine Zeit hat ist oder die Wohnung nicht barrierefrei ist.
Pflegebedarf ermitteln Pflegebedarf ermitteln
Sollte sich ein Angehöriger für die Pflege des Bedürftigen entscheiden, ist es zu Beginn sehr wichtig, dass der Pflegegrad des zu Betreuenden festgestellt wird – so wird der tatsächliche Pflegebedarf und -umfang ermittelt. Denn für die physische und psychische Belastung eines Pflegenden ist es ein gewaltiger Unterschied, ob jeglicher Aspekt der Pflege erledigt werden muss oder lediglich morgens Hilfe beim Anziehen oder im Haushalt benötigt wird.
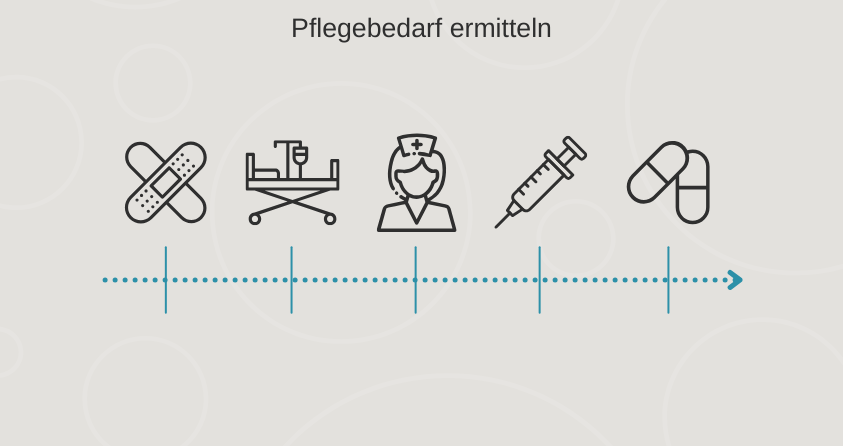
Ebenfalls spielt es für die tägliche Organisation eine große Rolle, ob der Betroffene unter Demenz leidet und somit eine 24-stündige Betreuung benötigt wird oder ob altersbedingt nur eine stundenweise Betreuung notwendig ist.
Ein Arzt und der Pflegegradrechner können dabei behilflich sein, den Pflegebedarf zu erfassen. Hierbei spielt der Unterstützungsbedarf sowie die vorhandene Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen eine große Rolle. Der Pflegegrad ist auch ein Idikator dafür welche Hilfsmittel für die Pflege notwendig sind. Sobald ein Angehöriger eine Unterstützung benötigt, kann ein Antrag auf einen Pflegegrad gestellt werden.

Pflegegradberatung
Wir helfen Ihnen mit der kostenlosen Erstberatung dabei, den Pflegegrade zu beantragen, ihn zu überprüfen oder zu widersprechen.
Nach der Antragsstellung wird ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) oder von MEDIPROOF (privat Versicherte) sich persönlich mit der Pflegeperson in Verbindung setzen. Der Gutachter kann sich dadurch ein eigenes Bild über den Pflegebedarf machen können: So wird der Unterstützungsbedarf genau ermittelt.
Informationen und Tipps zur Vorbereitung des MD-Besuchs finden Sie hier.
Persönliche Einstellung zur Pflege Persönliche Einstellung zur Pflege
Die Pflege eines Familienmitglieds kann eine große Herausforderung darstellen. Nicht jeder ist dem von Natur aus gewachsen. Bevor eine solche verantwortungsvolle Aufgabe angetreten wird, sollte überprüft werden, wie belastbar die pflegende Person tatächlich ist. Diese Fragen helfen bei der (Selbst-)Evaluation:
Wie gut ist das Verhältnis zum Pflegebedürftigen?
Ist die körperliche Fitness für die Pflege ausreichend?
Kann die Körperpflege des Angehörigen problemlos durchgeführt werden?
Ist genug Zeit vorhanden?
Besteht die Bereitschaft das eigene Leben auf den Pflegebedürftigen einzustellen?
Kann der Pflegeaufwand mit dem Job vereinbart werden?
Es ist wichtig zu überlegen mit welcher Motivation die Pflege übernommen wird. Wenn ein Elternteil oder der Partner nur aus Pflichtgefühl versorgt wird, kann es schnell zu Spannungen in der Beziehung kommen. Auch Liebe reicht als Bewegungsgrund oft nicht aus, wenn ohnehin eine mehrfach Belastung durch z.B. den Job besteht – Eine weitere Aufgabe führt unweigerlich zur Erschöpfung.
Eine Pflegesituation verändert die Beziehung Eine Pflegesituation verändert die Beziehung
Egal wie gut das Verhältnis zu einem Angehörigen ist: eine Pflegesituation erfordert eine ganz andere Form der Nähe. Die Eltern-Kind-Beziehung wird plötzlich umgedreht, da sich das Kind nun um die Eltern kümmern muss. In der Partnerschaft können sich die Rollen ebenfalls ändern, da der Pflegende als der „Stärkere“ wahrgenommen wird. Diese Neubestimmung kann beim Pflegebedürftigen zur Ablehnungshaltung führen. Im Gegenzug fehlt dem Pfleger die entsprechende Würdigung der Arbeit – eine zusätzliche Belastung also.
Die Pflege zu Hause bietet allerdings auch einige Vorteile für die Beteiligten. In einer Partnerschaft wird das Leben weiterhin gemeinsam gestaltet – es kann permanenter Austausch stattfinden. Auch fühlt sich der Pflegebedürftige zu Hause geborgener als in einem Pflegeheim und seine Selbstständigkeit kann leichter trainiert werden.
Problematisch wird die Pflegesituation jedoch, wenn sich der pflegende Angehörige oder Partner überfordert und dies nicht rechtzeitig erkannt wird. Da oft wenig Zeit für soziale Kontakte bleibt, kann zudem schnell in Gefühl der Isolation entstehen. Folgende Fragen sollte sich ein Pfleger daher regelmäßig stellen – Bereits wenn eine Frage mit "Ja" beantwortet werden kann, sollte sich um eine entsprechende Entlastung bemüht werden.
Fühle ich mich durch die Pflege gestresst?
Habe ich noch Zeit für mich selbst?
Habe ich körperliche Beschwerden, seitdem ich die Pflege übernommen habe?
Fühle ich mich ausgelaugt oder deprimiert?
Beruf und Pflege organisieren Beruf und Pflege organisieren
Als Berufstätiger muss die Pflege und Betreuung eines Angehörigen besonders gut geplant werden. Mehrere Aufgaben müssen unter einen Hut gebracht werden. Erste Auskünfte zur Pflegeunterstützung kann der Arzt, das Krankenhaus und die Krankenkasse des Betroffenen geben.
Umfangreiche Informationen und Hilfe bieten zudem die Pflegestützpunkte vor Ort. Auch ein Pflegedienst kann beraten und zugleich bei der Pflege entlasten. Das Sozialamt wiederum gibt Auskünfte über mögliche finanzielle Unterstützungen. Des Weiteren verfügen Selbsthilfegruppen zu entsprechenden Erkrankungen über einen reichen Erfahrungsschatz und können bei Fragen rund um die Pflege Tipps geben.
Sollte ein naher Angehöriger akut pflegebedürftig geworden sein, haben alle Berufstätigen das Recht, sich bis zu 10 Tage von der Arbeit freistellen zu lassen. In dieser Zeit muss die Organisation der Pflege gesichert oder Unterstützung geholt worden sein. Sollte der Arbeitgeber für die 10 freien Arbeitstage eine Bescheinigung benötigen, müssen Pflegepersonen diese Bescheinigung über eine voraussichtliche Pflegebedürftigkeit des Betroffenen vorlegen.
Die Inanspruchnahme dieser 10 Tage ist unabhängig von der Betriebsgröße und steht jedem Beschäftigten gesetzlich zu. Der Schutz der Pflege-, Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung bleibt während dieser Zeit bestehen. Als Ausgleich für ein entgangenes Gehalt steht ein Pflegeunterstützungsgeld zur Verfügung. Dieses Geld ist auf eben diese 10 Tage begrenzt. Für den Erhalt dieses Geldes spielt der Pflegegrad des Pflegebedürftigen keine Rolle. Das Unterstützungsgeld beträgt circa 90% des Nettoarbeitsentgeltes.
Pflegegeld
Durch das sogenannte Pflegegeld werden alle Pflegepersonen finanziell bei den Aufgaben rund um die Pflege unterstützt. Es wird durch die Pflegeversicherung gezahlt. Das Geld soll dafür verwendet werden, um alle notwendigen Pflegemaßnahmen und die pflegerische Betreuung sowie die Hilfe und Organisation im Haushalt zu sichern.
Das Geld wird immer an den Betroffenen selbst ausgezahlt. Je nach Pflegegrad ist die Höhe des Pflegegelds unterschiedlich. Während 316 Euro beim Pflegegrad 2 und 545 Euro beim Pflegegrad 3 ausgezahlt werden, liegt die Höhe des Pflegegeldes beim Pflegegrad 5 bei 901 Euro.
Pflegezeit und Familienpflegezeit Pflegezeit und Familienpflegezeit
Ein Beschäftigter kann sich durch die sogenannte Pflegezeit auch länger von der Arbeit freistellen lassen. Dadurch ist es möglich, einen Angehörigen in einer außerhäuslichen oder häuslichen Umgebung bis zu sechs Monate zu pflegen. Bei einer Freistellung wird der Beschäftigte allerdings nicht vom Arbeitgeber bezahlt. Die Pflegezeit kann auch nur einmalig gewährleistet werden. Oft folgt nach der Pflegezeit die Familienpflegezeit.
Eine Familienpflegezeit ist dafür gedacht, die Arbeitszeit von Beschäftigten für eine Dauer von bis zu 24 Monaten zu reduzieren. Der Beschäftigte muss in diesem Zeitraum eine Mindestarbeitszeit von bis zu 15 Wochenstunden erfüllen. Das reduzierte Gehalt kann durch ein zinsloses Darlehen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aufgestockt werden. Die Familienpflegezeit ergänzt und erweitert die Pflegezeit – zusammen dürfen sie längstens 24 Monate dauern.
Die Anmeldung muss mindestens 8 Wochen vor der Freistellung durchgeführt werden. Jede weitere Vereinbarung sollte zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer schriftlich fixiert werden. Ein Rechtsanspruch ist nur bei Betrieben möglich, die mehr als 25 Angestellte beschäftigt. Der Anspruch auf eine Familienpflegezeit ist nicht abhängig vom Pflegegrad des Bedürftigen – es ist allerdings Voraussetzung das überhaupt ein Pflegegrad vorhanden ist.
INFOS
➔ Weiterführende Informationen zur Familienpflegezeit und Pflegezeit.
Verhinderungspflege
Wenn der pflegende Angehörige krank wird oder in den Urlaub fahren möchte, hat der Pflegebedürftige Anspruch auf einen Pflegeersatz. Es ist hierfür keine vorherige Mindestpflegedauer der Pflegeperson notwendig. Diese Leistung der Pflegekasse nennt man Verhinderungspflege, die im Rahmen des Entlastungsbudgets für maximal acht Wochen (56 Tage) pro Jahr vergütet wird und auch stundenweise genutzt werden kann.
Hilfe für Angehörige Hilfe für Angehörige
Wenn ein Angehöriger ein Familienmitglied zu Hause pflegen möchte, jedoch keine Erfahrung darin hat, kann dieser sich in einer Pflegeschulung auf die Situation vorbereiten. Wenn der Betroffene einen Pflegegrad hat können auch Auskünfte durch Pflegeberater eingeholt werden – dies gehört zum Angebot der Pflegeversicherung. Die Schulungen sollen die betreffenden Personen auch vor Überforderungen bei der Pflege bewahren.

In einem Pflegekurs erhalten Angehörige praktische Hilfen und Beratungen, wie die häusliche Pflege kompetent und leichter durchgeführt werden kann. Sie lernen im Krankenhaus, wie sie die Angehörigen richtig versorgen und zugleich die eigenen Kräfte schonen. Dazu gehört unter anderem das Waschen des Betroffenen, Hilfe bei der Ernährung und bei Toilettengängen. Die Angehörigen haben auch die Möglichkeit, sich zur Entlastung mit anderen Pflegenden über Probleme zu unterhalten. Etliche Schulungen finden auch zu Hause bei dem Pflegebedürftigen statt, um unter realistischen Bedingungen zu üben.
Pflegekurse lassen sich bei gemeinnützigen Vereinen, Krankenversicherungen, ambulanten Pflegediensten oder in Fachkliniken finden. Dort werden Grundlehrgänge und spezielle Kurse für die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen angeboten. Personen mit keinerlei Vorkenntnissen, sollten einen Kurs wählen, der zunächst die Basispflege vermittelt, zum Beispiel, wie die tägliche Grundpflege durchgeführt wird, wie mit dem Kranken generell umgegangen, oder auf welche vorbeugenden Maßnahmen geachtet werden soll. Wenn kein Angebot in der Nähe angeboten wird, kann auch an Online-Pflegekursen teilgenommen werden. Hier fehlt allerdings die praktische Unterstützung.
Um die Pflege daheim zu erleichtern, ist es hilfreich einen oder mehrere Pflegekurse zu besuchen. Obwohl Interessierten beigebracht wird mit verschiedenen Pflegesituationen leichter umzugehen, sollte die Pflege nicht im Alleingang bewältigt werden – es ist ratsam sich die Unterstützung eines Pflegedienstes einzuholen. Die Mitarbeiter können Tipps und praktische Hilfen beim Umgang mit dem Pflegebedürftigen geben.

Online-Pflegekurse
Sie pflegen einen Angehörigen? Nutzen Sie die kostenlosen Online-Pflegekurse von curendo.
Wertvoll sind auch qualifizierte Pflegebegleiter, die den pflegenden Angehörigen mit Gesprächen unterstützen und diesen beim Umgang mit der Pflegeversicherung oder Ämtern Beratung anbieten. Pflegeberater gibt es bei gemeinnützigen Vereinen, zum Beispiel bei den Maltesern oder Johannitern. Auch im Internet finden sich Online-Beratungen zum Thema Pflege, falls schnell eine Auskunft benötigt wird.
Weiterführende Informationen

Pflegeexperte Florian Seybecke
Fachliche Expertise
Schulungsbeauftragter und Dozent
Fachkoordinator für neurologische Langzeitrehabilitation
Pflegedienstleitung und Schulungsbeauftragter
Fachkraft in der außerklinischen Intensivpflege
Ausbildung zum examinierten Altenpfleger






